![Symbolfoto: Falko Siewert/DRK Erste Hilfe, Ersthelfer, Leitstelle, Notruf, Rettungsdienst]() Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die fünf W’s abgefragt und die entsprechenden Rettungsmittel alarmiert. Häufig sind Ersthelfer aber in ihnen unbekannten Gebieten unterwegs und können nicht genau beschreiben, wo der Einsatzort sich befindet. Die Anrufer nehmen an, die Leitstelle könne sie genau orten. Doch dies ist ein Irrtum. Hier unsere Tipps, wie Sie in dieser Situation Ihre Position mit Ihrem Smartphone bestimmen können.
Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die fünf W’s abgefragt und die entsprechenden Rettungsmittel alarmiert. Häufig sind Ersthelfer aber in ihnen unbekannten Gebieten unterwegs und können nicht genau beschreiben, wo der Einsatzort sich befindet. Die Anrufer nehmen an, die Leitstelle könne sie genau orten. Doch dies ist ein Irrtum. Hier unsere Tipps, wie Sie in dieser Situation Ihre Position mit Ihrem Smartphone bestimmen können.
Ein Mountainbiker stürzt im Wald und bleibt regungslos liegen. Zufällig beobachtet ein Spaziergänger den Vorfall und setzt über die 112 einen Notruf ab. Doch als der Disponent ihn nach der Einsatzstelle fragt, muss der Spaziergänger passen. Der Mann weiß nicht, wo er sich befindet.
Situationen wie diese ereignen sich häufig. Was also tun, wenn der Standort nicht ermittelt werden kann?
Mehr zum Thema Notruf
Notruf: Ortung über den Mobilfunksender
Zunächst ist es der Leitstelle möglich, die Funkzelle des Anrufers auszumachen. Die „Verordnung über Notruf Verbindungen“ (NotrufV) nimmt den Mobilfunk-Anbieter bei einem Notruf in die Pflicht, der Leitstelle den Mobilfunksender mitzuteilen, über den der Ersthelfer oder die verletzte Person anruft.
Diese Ortung via GSM (Global System for Mobile Communications) ist allerdings häufig ungenau. Grund: Außerorts kann die Funkzelle eines Mobilfunksenders mehrere Quadratkilometer betragen. Zur Erinnerung: Ein Quadratkilometer entspricht der Größe von etwa 140 Fußballfeldern! Weiterhin verfügen noch nicht alle Leitstellen über die Möglichkeiten, diese Daten direkt abzurufen.
Notruf: Ersthelfer muss GPS-Koordinaten selbst durchgeben
Gesetzlich nicht festgelegt, aber wesentlich genauer ist das Global Positioning System (GPS). Zudem ist in nahezu allen neueren Mobiltelefonen ein GPS-Empfänger verbaut, mit dessen Hilfe ein Ersthelfer der Leitstelle seinen Standort auf wenige Meter genau mitteilen kann.
Noch genauer kann eine Position bestimmt werden, wenn sich in der Nähe mehrere öffentliche WLAN-Spots befinden. Dann kann das Smartphone anhand der Signalstärke der verfügbaren kabellosen Netze und zusammen mit den GPS-Koordinaten eine so genannte „hybride Lokalisierung“ berechnen.
Wer Erste Hilfe leistet beziehungsweise sich in einer Notsituation befindet, muss seinen Standort jedoch selbst ermitteln und der Leitstelle durchgeben. Auch die Polizei kann lediglich eine GSM-Ortung beim Netzanbieter beantragen.
Erste Hilfe durch kostenlose GPS-Apps
Auf dem Markt existiert eine Vielzahl kostenloser Apps für diesen Zweck. Beispielhaft erwähnt werden hier die App „Einfach hier“ (iOS) oder die App „Standort“ (Android). Beim iPhone ist es ferner möglich, sich die GPS-Koordinaten über den integrierten Kompass anzeigen zu lassen.
Anleitung für iPhone:
![]()
![]()
![]()
![]()
Eigentlich als Datenkrake in Verruf geraten, hat WhatsApp einen großen Vorteil: Mehr als 35 Millionen Menschen nutzen Medienberichten zufolge den Nachrichtendienst in Deutschland. Daher setzen einige Leitstellen die App auch ein, um Ersthelfer oder Hilfsbedürftige zu orten, die einen Notruf abgesetzt haben. Zum Beispiel die Leitstellen Düsseldorf und Brandenburg. Der Disponent hat dort ein Gerät zur Verfügung, auf dem WhatsApp installiert ist. Geht ein Notruf bei ihm ein, leitet er das Unfallopfer oder den Ersthelfer an, sein Smartphone richtig einzustellen und die Standortkoordinaten zu senden.
Anleitung für WhatsApp:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Es gibt sogar eine App speziell für Waldgebiete: „Hilfe im Wald“. Diese zeigt nicht nur die eigene GPS-Position an, sondern zusätzlich die in der Nähe befindlichen Rettungspunkte. Rettungspunkte sind Anfahrtsstellen für Rettungsfahrzeuge. Sie sind in vielen Wäldern Deutschlands vorhanden und durch Schilder mit einer speziellen Nummer markiert (wir berichteten). Allerdings weicht das optische Design der Schilder regional stark ab. In einigen Bundesländern sind zudem bislang keine Rettungspunkte vorhanden.
Anleitung für Hilfe im Wald
![]()
![]()
![]()
Ähnlich wie die Rettungspunkte, existiert im Schwarzwald seit August 2017 ein Netz von Wegepunkten für Wanderer. Die Punkte sind auf den öffentlichen Schildern für die Wanderrouten zu sehen. Telefoniert ein Ersthelfer mit der Leitstelle, kann er einen Wegepunkt durchgeben. Der Disponent findet den Punkt samt Koordinaten in seinem System und kann dann den Rettungsdienst zu der Stelle leiten.
DGzRS: Sicherer Törn mit SafeTrx
![© DGzRS]() Die Kreuzpeilung von Funkgeräten in Seenot geratener Personen ist in Zeiten von GPS-Plottern auf den meisten Schiffen selten geworden. Derweil verfügen kleinere Boote oder Wassersportler wie zum Beispiel Surfer, Kayakfahrer, Kiter oder auch Wattwanderer und Angler nicht über diese Geräte. Um diese Lücke zu schließen, gibt es seit Jahresbeginn 2017 die App „SafeTrx“ von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die App ist kostenlos und für iOS sowie Android verfügbar.
Die Kreuzpeilung von Funkgeräten in Seenot geratener Personen ist in Zeiten von GPS-Plottern auf den meisten Schiffen selten geworden. Derweil verfügen kleinere Boote oder Wassersportler wie zum Beispiel Surfer, Kayakfahrer, Kiter oder auch Wattwanderer und Angler nicht über diese Geräte. Um diese Lücke zu schließen, gibt es seit Jahresbeginn 2017 die App „SafeTrx“ von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Die App ist kostenlos und für iOS sowie Android verfügbar.
Wie funktioniert die Software? Antke Reemts von der DGzRS: „SafeTrx ist eine App, mit der wir die Position von Menschen bestimmen können, die in Seenot geraten sind. Nutzer der App, also zum Beispiel Wassersportler, können im ‚Routenplan-Modus‘ eine Strecke vorgeben, die sie zurücklegen möchten. Unterwegs sendet die App dann regelmäßig GPS-Positionen an uns. Ist mal keine Mobilfunkanbindung vorhanden, werden die Daten auf dem Gerät gespeichert und bei der nächsten Netzverfügbarkeit gesendet.“
![© DGzRS]()
Monitoring Konsole des MRCC Bremen für SafeTrx. Für jeden Wegpunkt lassen sich die Koordinaten aufrufen. (Live-Bildausschnitt) Foto: DGzRS
Erreicht der Nutzer sein Ziel nicht in der vorher festgelegten Zeit, wird er selbst erinnert. Er kann dann eine neue Ankunftszeit angeben. Macht er dies nicht, wird 15 Minuten später eine SMS an eine Person geschickt, dessen Nummer der Nutzer für den Notfall hinterlegt hat. Dieser Notfall-Kontakt meldet sich dann beim Nutzer. Erreicht der Kontakt den Nutzer nicht, kann er daraufhin die Seenotleitung informieren.
„Wir können dann die festgelegte Route sowie die gesendeten GPS-Positionen nachvollziehen und uns auf die Suche machen“, so Reemts weiter. „Mithilfe der App kann man selbstverständlich auch selbst einen Notruf absetzen. Mit der Notruf-Funktion werden zeitgleich die GPS-Koordinaten sowie Kurs und Geschwindigkeit an die Seenotleitung übermittelt.“
Theoretisch funktioniert SafeTrx auch für Notfälle auf Binnengewässern oder bei Spaziergängen im Wald. Ein Notruf, der über die App bei der Seenotleitung ankommt, wird dann samt der Koordinaten an die zuständige Behörde beziehungsweise Leitstelle weitergeleitet.
Die App hat sich bereits als zuverlässig erwiesen. „Wir konnten mit SafeTrx einen Havaristen mit einem Motorschaden auf der Ostsee orten und sogar eine Suchaktion verhindern: Ein Augenzeuge hatte einen Kayakfahrer gesehen, der auf einer Sandbank festsaß, und setzte einen Notruf ab. Die Seenotleitung stellte daraufhin fest, dass der Wassersportler die App nutzte. Der Disponent konnte ihn direkt anrufen und feststellen, dass alles in Ordnung ist“, berichtet Antke Reemts. „Außerdem kann man die App überall auf der Welt nutzen.“
Anleitung SafeTrx
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
(Noch) Keine einheitliche Notruf App vom Bund
Eine für alle Situationen ideale und vor allem einheitliche Lösung existiert bislang nicht. Eine App für den „barrierefreien Notruf“, wie ursprünglich von SPD und CDU im Koalitionsvertrag 2013 vereinbart, fehlt bis heute. Insbesondere Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen sind auf Grund dessen bislang auf kostenpflichtige Notruf-Apps angewiesen.
Allerdings ist eine Notruf-App vom Bund in einer Erprobungsphase. Laut Pressemitteilung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie sollen ausgewählte Leitstellen einen Prototyp der Notruf-App bis Frühjahr 2018 testen. Die Software soll für alle gängigen Smartphone-Plattformen verfügbar und in jeder Leitstelle Deutschlands einsetzbar sein.
Leitstelle Freiburg mit eigener Lösung
Grundsätzlich besteht der Nachteil einer App – einfach gesagt – darin, dass viele Nutzer sie nicht installiert haben. Für den Notruf setzt die Integrierte Leitstelle Freiburg daher auf eine hauseigene Lösung: Ist ein Ersthelfer während des Notrufs nicht in der Lage, seinen Standort exakt zu bestimmen, kann die Leitstelle ihm eine SMS schicken.
„Wenn der Notrufende auf den Link in der SMS klickt, öffnet sich der Webbrowser und versucht über die eingebaute Geolocation-Funktion – eventuell nach vorheriger Zustimmung beziehungsweise Sicherheitsabfrage – die aktuelle Position zu ermitteln“, erläutert Henning Schmidtpott, Disponent und Systemadministrator der Leitstelle sowie Entwickler des Systems. „Es ist lediglich ein handelsübliches Smartphone notwendig, und es muss keine App installiert werden“, so Schmidtpott weiter.
Bei zirka 110.000 Notrufen, die jährlich in der Leitstelle Freiburg eingehen, hat die Methode sich bewährt. Schmidtpott: „Wir konnten einen Fahrradfahrer lokalisieren, der in Freiburg gestürzt war. Er war auf dem Dreisamuferweg unterwegs und wusste nicht, auf welcher Höhe er sich befand. Die Straße zieht sich durch die komplette Stadt. Durch die Positionsbestimmung konnten wir ihn in kürzester Zeit auf 12 Meter genau verorten.“
Außerdem ist dem Disponent noch der Notruf einer Wandergruppe in Erinnerung. Einer der Wanderer hatte einen medizinischen Notfall erlitten, und die Gruppe war weit von jeglicher Straße entfernt. „Mit unserem System gaben die Ersthelfer ihren Standort durch, und wir konnten die nötige Hilfe alarmieren.“
![]() Gürtel aus Leder mit „Star of Life“ für nur 19,90 Euro
Gürtel aus Leder mit „Star of Life“ für nur 19,90 Euro
Schwarzer Gürtel aus hochwertigem Rindleder mit „Star of Life„. Bestens geeignet für Dienst und Freizeit!
Egal, ob festlich oder leger – dieser Ledergürtel passt immer und überall. Sieht garantiert super aus zu jeder Jeans oder anderen Freizeithose.
Doch auch hier gibt es Grenzen. „Die Datenübermittlung funktioniert nur, wenn eine Internetverbindung vorhanden ist und Notrufende in ihrem Smartphone die Geolokationsdienste aktiviert haben. Wenn die GPS-Funktion deaktiviert ist, muss sie im Notfall dann erst in den Einstellungen aktiviert werden. Für einige Smartphone-Nutzer ist dies eine unüberwindbare Hürde. In jedem Fall kostet es aber Zeit“, betont der Systemadministrator der Leitstelle.
In der Integrierten Leitstelle Allgäu denkt man ebenfalls über ein GPS-basiertes Ortungssystem nach. Aus den knapp 92.000 Rettungsdiensteinsätzen im Jahr 2014 waren über 7.000 der Bergrettung und Wasserrettung zuzuschreiben. Einsätze, in denen die Lokalisierung der Patienten sich häufig schwierig gestaltet. Marco Arhelger, Leiter der Leitstelle: „Wir sind noch in der Markterkundung für ein geeignetes System. Ende 2017 wollen wir aber auch dementsprechend ausgerüstet sein.“
Nicht nur Rettungsleitstellen nutzen die technischen Möglichkeiten. Auch Leitstellen der Polizei rüsten auf. Die Polizei Bayern beispielsweise verfügt seit Anfang 2017 über ein ähnliches System wie die Leitstelle Freiburg.
AML: Die Zukunft heißt „Advanced Mobile Location“
Bei der Björn-Steiger-Stiftung hofft man indes auf eine ganz andere Technologie: AML (Advanced Mobile Location). „AML ist momentan auf nahezu allen Android-Geräten implementiert“, erläutert Manolito Leyeza, Projektmanager für Notruf-Informationssysteme bei der Björn-Steiger-Stiftung. Die Funktionsweise ist simpel. „Das Handy erkennt, dass jemand die nationale Notruf Nummer wählt. Automatisch werden daraufhin alle Standort-Funktionen aktiviert. Noch während ein Erste-Hilfe-Leistender oder eine verletzte Person mit dem Disponenten spricht, sammelt sein Gerät für etwa 20 Sekunden alle Informationen über GPS-Koordinaten, Mobilfunkzellen und umliegende WLAN-Netze. Dann werden die gesammelten Daten an eine zentrale Stelle einer Notrufzentrale geschickt“, erklärt Leyeza.
Die Daten können per SMS oder als Datenpaket an die jeweilige Stelle (etwa den Server einer zentralen Leitstelle) verschickt werden. Anhand der Mobilfunknummer des Anrufers kann dann der Disponent auf diese Daten zugreifen und somit seinen Standort – ohne dessen Zutun – ermitteln.
„Und AML ist dabei auch noch sehr kostengünstig und einfach umsetzbar“, so der Projektmanager weiter. „Litauen beispielsweise hat das System für das gesamte Land innerhalb von vier Monaten in seine Leitstellen integrieren können. Kostenpunkt: 50.000 Euro!“
Sogar in Sachen Datenschutz kann die Software punkten, die Google zusammen mit Smartphone-Herstellern entwickelt hat. Die über AML gesendeten Daten gehen nur an die Leitstelle und werden nicht auf dem Gerät gespeichert oder gar an Dritte übertragen.
Zudem sei AML dafür konzipiert, um Zusatzfunktionen erweitert zu werden. Leyeza: „Man könnte zum Beispiel Dinge wie einen elektronischen Notfallpass ohne Weiteres implementieren.“
Der Ortungsdienst für den Notruf wird bereits unter anderem in Großbritannien, Litauen, Estland und einigen österreichischen Bundesländern verwendet.
In Deutschland ist man hingegen noch nicht soweit. „Die Leitstellen in Deutschland sind noch nicht einmal dazu verpflichtet, ein System zu haben, womit sie GSM-Daten erfassen können“, kommentiert Manolito Leyeza. „Im Gesetz ist nur geregelt, dass eine Leitstelle telefonisch und per Fax erreichbar sein muss. Ich sehe es daher in allernächster Zukunft noch nicht, dass über AML im Bundestag diskutiert wird.“
„Dabei wäre datenschutzmäßig alles auf der sicheren Seite, wenn man die Verwendung von AML in der Notruf-Verordnung festlegen würde“, appelliert der Projektmanager für Notruf-Informationssysteme. Doch das ist noch Zukunftsmusik.
(Text und Screenshots: Nils Sander, rettungsdienst.de; 31.08.2017; Symbolfoto: Falko Siewert/DRK ) [1203]

 Bremen (rd_de) – Mitarbeiter in deutschsprachigen Feuer- und Rettungsleitstellen erleben es immer wieder, dass sie Notrufe von Menschen annehmen, die kein oder nur gebrochen Deutsch sprechen. Erste Ausweichsprache ist dann in der Regel Englisch. Doch vielfach handelt es sich beim Anrufer um keinen englischen Muttersprachler. Und das Schul-Englisch des Disponenten ist oft eingerostet. Höchste Zeit, sein „Notfall-Englisch“ aufzupolieren!
Bremen (rd_de) – Mitarbeiter in deutschsprachigen Feuer- und Rettungsleitstellen erleben es immer wieder, dass sie Notrufe von Menschen annehmen, die kein oder nur gebrochen Deutsch sprechen. Erste Ausweichsprache ist dann in der Regel Englisch. Doch vielfach handelt es sich beim Anrufer um keinen englischen Muttersprachler. Und das Schul-Englisch des Disponenten ist oft eingerostet. Höchste Zeit, sein „Notfall-Englisch“ aufzupolieren!
 Stuttgart (IM BW/rd_de) – Eine Projektgruppe im Innenministerium Baden-Württembergs ist seit vergangenem Montag (05.12.2016) dabei, die Struktur der Integrierten Leitstellen für Feuerwehr und Rettungsdienste im Land zu untersuchen.
Stuttgart (IM BW/rd_de) – Eine Projektgruppe im Innenministerium Baden-Württembergs ist seit vergangenem Montag (05.12.2016) dabei, die Struktur der Integrierten Leitstellen für Feuerwehr und Rettungsdienste im Land zu untersuchen. 
 Bremen (rd_de) – Vater oder Mutter müssen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das oder die minderjährigen Kinder wären danach allein zu Haus. Wie sollte die Leitstelle reagieren?
Bremen (rd_de) – Vater oder Mutter müssen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das oder die minderjährigen Kinder wären danach allein zu Haus. Wie sollte die Leitstelle reagieren?
 Bremen (rd_de) – „Einsatz mit Alarm“, teilt die Leitstelle der RTW-Besatzung mit. Automatisch schalten Rettungskräfte daraufhin Blaulicht und Signalhorn ein. Warum? Weil die Weisungsbefugnis der Leitstelle dies vorgibt?
Bremen (rd_de) – „Einsatz mit Alarm“, teilt die Leitstelle der RTW-Besatzung mit. Automatisch schalten Rettungskräfte daraufhin Blaulicht und Signalhorn ein. Warum? Weil die Weisungsbefugnis der Leitstelle dies vorgibt? Mannheim/Heidelberg (rd_de) – Seit rund zwei Jahren streiten sich Mannheim und Heidelberg darüber, wer von ihnen Standort der neuen, gemeinsamen Integrierten Leitstelle werden soll (
Mannheim/Heidelberg (rd_de) – Seit rund zwei Jahren streiten sich Mannheim und Heidelberg darüber, wer von ihnen Standort der neuen, gemeinsamen Integrierten Leitstelle werden soll ( Bremen (rd_de) – Wer an seinem Funkgerät die Taste für „Status 4“ drückt, signalisiert der Leitstelle, dass die Einsatzstelle erreicht worden ist. Welche Konsequenzen es haben kann, diese Taste zu früh zu drücken, ist vielen Rettungsdienst-Mitarbeitern aber nicht klar.
Bremen (rd_de) – Wer an seinem Funkgerät die Taste für „Status 4“ drückt, signalisiert der Leitstelle, dass die Einsatzstelle erreicht worden ist. Welche Konsequenzen es haben kann, diese Taste zu früh zu drücken, ist vielen Rettungsdienst-Mitarbeitern aber nicht klar. Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die
Bremen (rd_de) – Tritt ein medizinischer Notfall ein, gilt in den meisten Ländern Europas: den Notruf 112 wählen. In der Leitstelle werden dann die 



















 Berlin (rd_de) – Auf Rettungsleitstellen könnten große Veränderungen zukommen. Am Donnerstag (07.09.2017) stellte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) seine Empfehlungen zur Zukunft der Notfallversorgung in Deutschland vor. Würden die Ideen 1:1 umgesetzt, träfe das vor allem die Leitstellen.
Berlin (rd_de) – Auf Rettungsleitstellen könnten große Veränderungen zukommen. Am Donnerstag (07.09.2017) stellte der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) seine Empfehlungen zur Zukunft der Notfallversorgung in Deutschland vor. Würden die Ideen 1:1 umgesetzt, träfe das vor allem die Leitstellen.
 Bremen (rd_de) – Ohne die Rettungsleitstelle wäre kaum ein Notfalleinsatz denkbar. Warum aber füllen rechtliche Probleme im Rettungsdienst so viele Bücher, ohne dass dabei tiefergehend an die Disponenten in der Rettungsleitstelle gedacht wird? Vielleicht, weil sie ja nur im Hintergrund agieren?
Bremen (rd_de) – Ohne die Rettungsleitstelle wäre kaum ein Notfalleinsatz denkbar. Warum aber füllen rechtliche Probleme im Rettungsdienst so viele Bücher, ohne dass dabei tiefergehend an die Disponenten in der Rettungsleitstelle gedacht wird? Vielleicht, weil sie ja nur im Hintergrund agieren? 
 Berlin (DIVI) – Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) befürwortet grundsätzlich eine Neustrukturierung der Notfallversorgung in Deutschland. Zu den Empfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (
Berlin (DIVI) – Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) befürwortet grundsätzlich eine Neustrukturierung der Notfallversorgung in Deutschland. Zu den Empfehlungen des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (




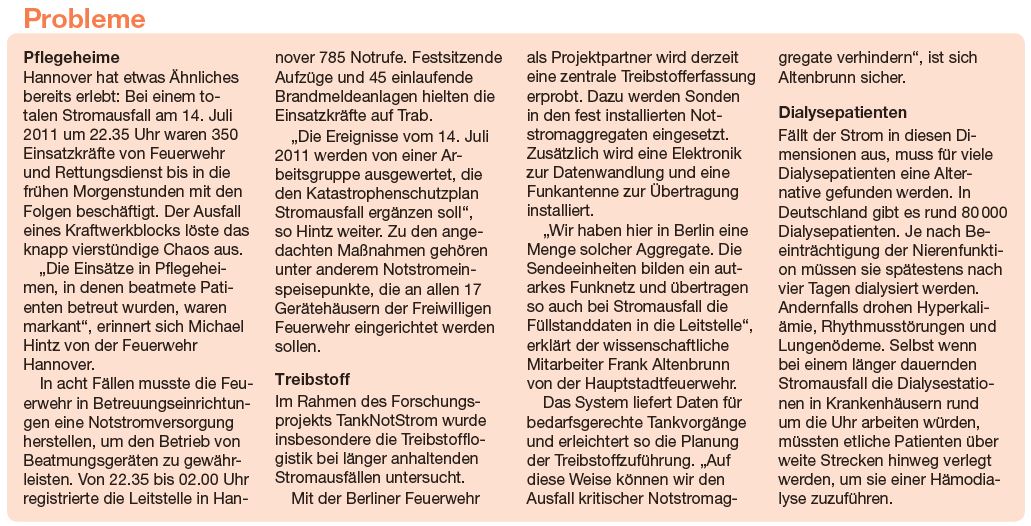


 Bremen (rd_de) – So genannte Ersthelfer-Apps sollen dafür sorgen, dass ein qualifizierter Ersthelfer schneller zur Stelle ist. In mehreren Regionen sind bereits verschiedene Systeme im Einsatz.
Bremen (rd_de) – So genannte Ersthelfer-Apps sollen dafür sorgen, dass ein qualifizierter Ersthelfer schneller zur Stelle ist. In mehreren Regionen sind bereits verschiedene Systeme im Einsatz.
 Bremen (rd_de) – Die Berliner Feuerwehr hat für ihre Notfallsanitäter-Ausbildung ein besonderes Konzept entwickelt. Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden zu so genannten „112 Medics“ ausgebildet. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im neuen Rettungs-Magazin (2/2018). Weitere Themen sind unter anderem Praxistipps für das Airwaymanagement sowie ein Rückblick auf den Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg.
Bremen (rd_de) – Die Berliner Feuerwehr hat für ihre Notfallsanitäter-Ausbildung ein besonderes Konzept entwickelt. Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden zu so genannten „112 Medics“ ausgebildet. Was es damit auf sich hat, lesen Sie im neuen Rettungs-Magazin (2/2018). Weitere Themen sind unter anderem Praxistipps für das Airwaymanagement sowie ein Rückblick auf den Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg. Stuttgart (DRK) – Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Baden-Württemberg positioniert sich zum Rettungsdienst der Zukunft. Im Rahmen eines Pressetermins am Dienstag (08.05.2018) in Stuttgart erläuterten die beiden DRK-Landesverbände ihre Kernpunkte für eine künftige Sicherstellung des Systems.
Stuttgart (DRK) – Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Baden-Württemberg positioniert sich zum Rettungsdienst der Zukunft. Im Rahmen eines Pressetermins am Dienstag (08.05.2018) in Stuttgart erläuterten die beiden DRK-Landesverbände ihre Kernpunkte für eine künftige Sicherstellung des Systems.